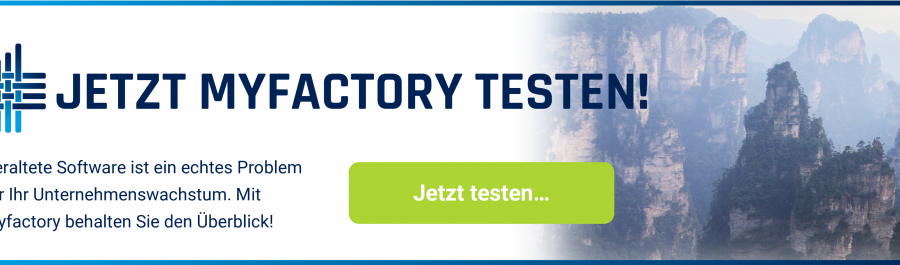Beabsichtigtes oder irrtümliches Löschen, ein Cyber-Angriff oder ein durch ausgefallene Server oder eine ungeplante Downtime im (Cloud-)Rechenzentr
Kategorie: ERP-News
Alles was man über CRM-Implementierungen wissen muss!
Eine CRM-Implementierung ist ein Prozess, bei dem ein Unternehmen eine Kundenbeziehungssoftware oder -plattform implementiert, um seine Kundenbezieh
Kollaborative Intelligenz: Der Schlüssel zu einem wirklich authentischen Kundenerlebnis
Ein guter Kundenservice basiert auf Vertrauen und Authentizität. Wenn Kunden einen Ansprechpartner suchen, haben sie in der Regel alle anderen Mögl
Genial oder Augenwischerei? Welchen Effekt haben paketfreie Retouren
„Unsere Kunden wollen alles und zu jeder Zeit.“ So lautet vielerorts das Credo des Online-Handels. Customer Convenience ist dabei oftmals das Zau
Die drei häufigsten Risiken mangelnder Datensicherheit und ihre Ursachen
Jährlich entsteht deutschen Unternehmen laut Digitalverband Bitkom ein Schaden von 223 Milliarden Euro aufgrund krimineller Angriffe. Ob durch Wirts
Wie smarte Unternehmen den War for Talents gewinnen
Die Arbeitslosenquote in Deutschland befindet sich auf einem historischen Tiefstand; Unternehmen jeder Größe suchen händeringend nach Fachpersonal
Unternehmensberatung für den Mittelstand: Checkliste für die Beauftragung externer Berater
Besonders mittelständische Unternehmer sind oftmals skeptisch, ob Außenstehende Ihnen kompetent weiterhelfen können. Gleichzeitig hat der Mitte
Zufriedenheit ist bares Geld wert: Der ROI von Customer Experience Management
Gerade in Krisenzeiten müssen sich Unternehmen und Händler ihre Marktposition hart erkämpfen – und sie vehement verteidigen. Denn Produkte und A
ERP-Software: Welche Anwendungsbereiche gibt es?
Enterprise Ressource Planning (ERP) halten viele auf den ersten Blick für eine reine Verwaltungs- und Logistik-Hilfe. Doch ERP kann viel mehr als da
Business-Trends 2023: Agilität erreicht neuen Reifegrad
Die zurückliegenden Monate haben die Weltwirtschaft sowie die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Forciert durch die Folgen der Pandemie, der weltwei