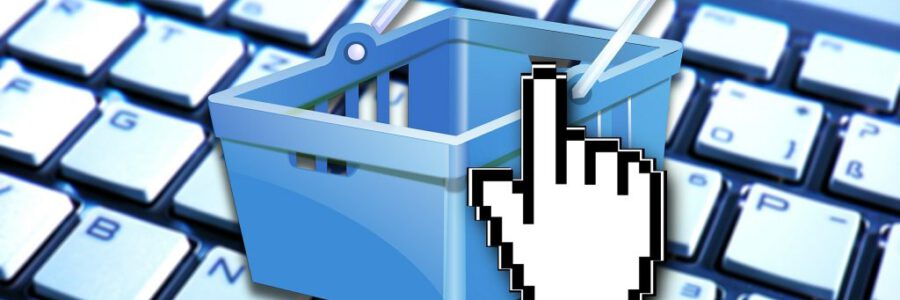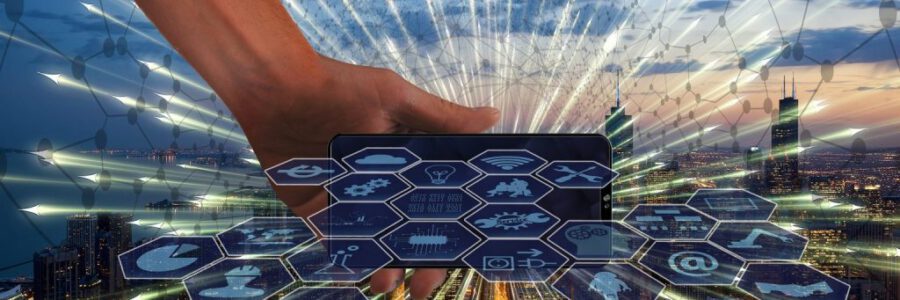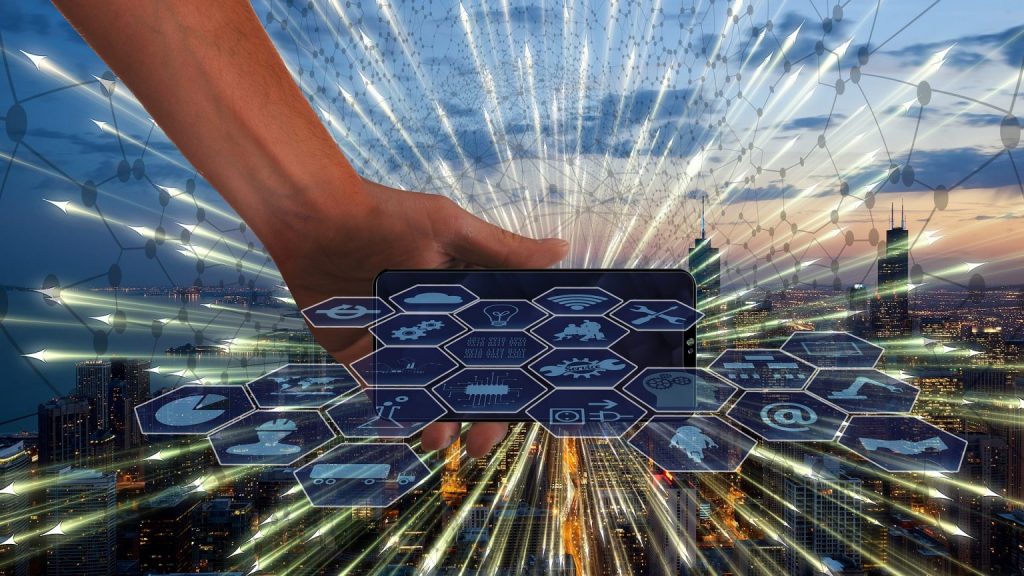Sowohl Hersteller als auch Händler bedienen längst nicht mehr nur einen Kanal: Die Anzahl der Touchpoints nimmt stetig zu und überall erwarten Kunden und Interessenten konsistente und stets aktuelle Produktinformationen.
8 Fehler, die Hersteller und Händler bei der Einführung eines PIM unbedingt vermeiden sollten
Verlässliche und ansprechende Artikelbeschreibungen und zwar überall – im Online-Shop, im Katalog und am Point of Sale – gehören im B2C und B2B zu den Erfolgsfaktoren. Ein Product Information Management System (PIM-System) kann sie dabei unterstützen, den Ansprüchen ihrer Zielgruppe gerecht zu werden. Doch bevor alle Produktdaten zentralisiert und in einem PIM-System implementiert werden, gibt es einige Aspekte zu beachten, bei denen Unternehmen nur allzu gern Fehler unterlaufen. Nachfolgend identifiziert SDZeCOM 8 Fehler, die Sie vermeiden sollten:
1. Allheilmittel Software
Zu glauben, die Anschaffung eines PIM sei die Garantie für reibungslose Omnichannel-Kommunikation, ist ein folgenschwerer Fehler. Ohne entsprechende Prozesse und Verantwortlichkeiten ist die Software „herausgeworfenes Geld“.
2. PIM-Einführung als Hauruck-Aktion
Die PIM-Implementierung kann nicht von jetzt auf gleich erfolgen, sondern stellt einen sukzessiven Wandel dar. Eine agile Vorgehensweise in kleinen Schritten mit unmittelbaren Ergebnissen ist am besten geeignet, um notwendige Anpassungen schnell und flexibel vornehmen zu können.
3. Fehlendes Change Management
Die neue Struktur und der veränderte Datenverwaltungsprozess müssen vom Management vorgelebt und begleitet werden. Zudem gilt es, Mitarbeiter frühzeitig ins Boot zu holen und mögliche Widerstände einzukalkulieren.
4. Die eierlegende Wollmilchsau suchen
Ein System zu finden, das alles leisten kann, ist unmöglich. Ob CRM (Customer Relationship Management) und ERP (Enterprise Resource Planning), Marketing-Automation und Webshop – jedes System hat seine Stärken und Einsatzgebiete. Diese Systeme sinnvoll zu verknüpfen, ist dabei die Herausforderung.
5. Redundante Datenhaltung in mehreren Quellen
Wichtigste Voraussetzung für eine effiziente Produktkommunikation im Omnichannel ist eine zentrale Datenbasis – und zwar dort, wo die Produkte „entstehen“: Häufig liegen erste Produktdaten bereits im ERP-System gesammelt vor. Dann sollten von diesem führenden System aus alle weiteren Systeme, Benutzergruppen, Kanäle usw. nach und nach angebunden werden.
Bei dem Begriff ERP wird heute oft eine Software von SAP verbunden. Sprechen Experten von ERP so meinen die erst Mal: Enterprise Resource Planning, also den generellen Prozess im Unternehmen vorhandenen Ressourcen zu planen und steuern. Erfahren Sie auf unserer Themen-Seite mehr darüber …
6. Kompliziertes Berechtigungskonzept
Insbesondere in der Omnichannel-Kommunikation gibt es häufig kanalspezifische Berechtigungen. Für den erfolgreichen Einsatz eines PIM-Systems ist es jedoch wichtig, das Berechtigungskonzept gut zu durchdenken, flexibel anzupassen und vor allem übersichtlich zu halten, damit Produktdaten konsequent an einer Stelle aktualisiert werden können.
7. Alle Kanäle auf einen Schlag
Statt alle Kanäle mit einem Mal hinzuzufügen, ist es effizienter, auf Projekt-Treiber zu setzen, die schnell Erfolge erzielen. Das gewährleistet die nötige Flexibilität, wenn es um Anpassungen geht, und motiviert Mitarbeiter für die Veränderung. Hat man im Omnichannel-PIM beispielsweise die Wahl, Datenblätter zu aktualisieren oder den Hauptkatalog neu aufzulegen, empfiehlt es sich, zunächst die Datenblätter in Angriff zu nehmen und erst im zweiten Schritt unter Einbezug von Marketing und Vertrieb die Katalogerstellung zu planen.
8. Fehlende Verknüpfung der Kanäle
Eine ausgereifte Omnichannel-Strategie, die die einzelnen Kanäle im PIM verknüpft, ist unverzichtbar. Nur so können Unternehmen die Potenziale eines PIM ausschöpfen und dem (potenziellen) Kunden eine konsistente Customer Experience an allen Touchpoints ermöglichen.





 , der globale Anbieter für Business Software, fünf zentrale Empfehlungen.
, der globale Anbieter für Business Software, fünf zentrale Empfehlungen.