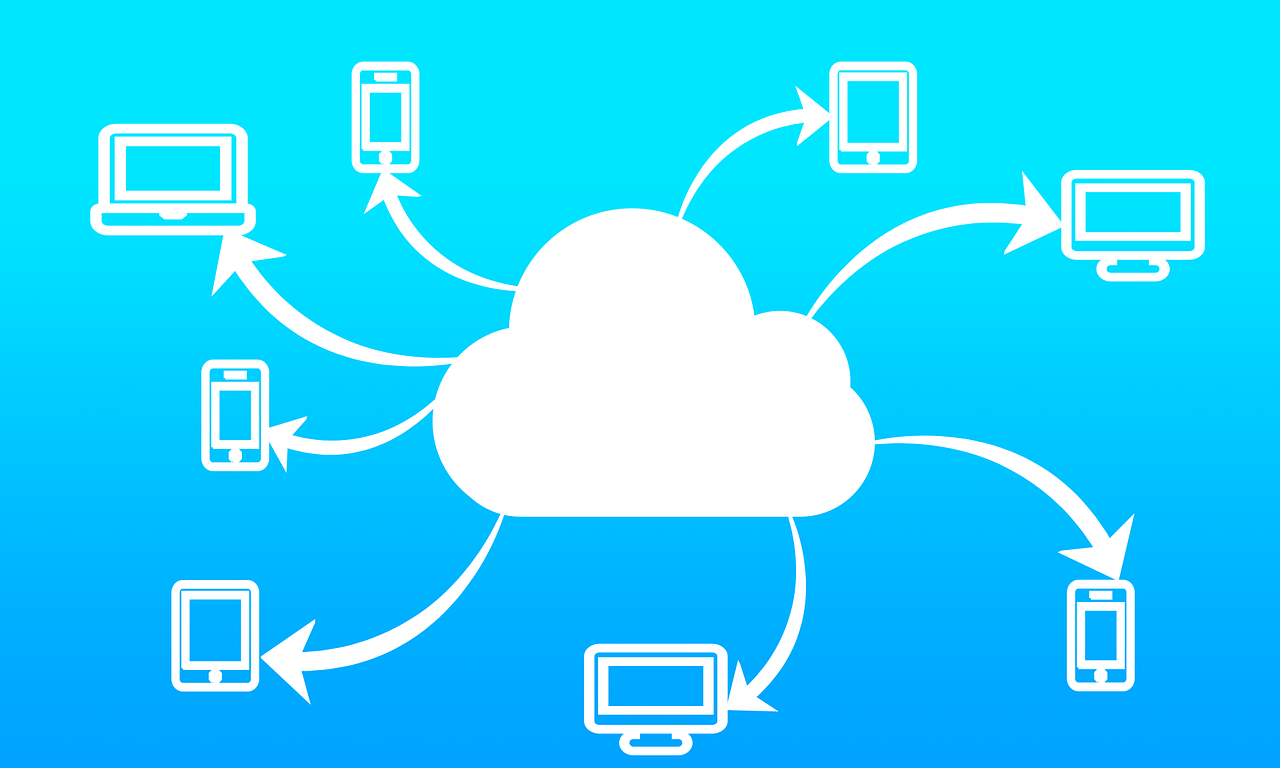Wir erläutern, mit welcher Messmethode Unternehmen die Customer Experience ihrer Kunden erfolgreich und wirtschaftlich steuern können.
In sechs Schritten zum erfolgreichen Customer Experience Management
In Zeiten eines immer umkämpfteren Marktumfelds ist die Customer Experience das ausschlaggebende Differenzierungsmerkmal. Wollen Unternehmen Kunden an sich binden und von ihnen weiterempfohlen werden, müssen sie sie mit ihren Services und Angeboten begeistern. Das Customer Experience Management – also die Messung und Steuerung der Kundenerlebnisse – wird damit zu einer entscheidenden Stellgröße für den Unternehmenserfolg.
Herkömmliche Messmethoden zur Kundenbindung und zum Kundenverhalten wie der Net Promoter Score oder das Conversion-Modell greifen dabei zu kurz. So beziehen sie beispielsweise nicht alle relevanten Touchpoints ein und berücksichtigen auch die Perspektive der Kunden und ihre Erwartungshaltung nicht ausreichend. Es empfiehlt sich deshalb einen umfassenden Ansatz, der folgende Parameter berücksichtigt:
Erwartungen
Mit welchen Motiven, Einstellungen und Fragen tritt der Kunde in Kontakt mit dem Unternehmen?
Touchpoints
Welche Kontaktpunkte hat der Kunde mit dem Unternehmen?
Erlebnisse
Welche positiven oder negativen Erlebnisse erfährt der Kunde am Kontaktpunkt?
Relevanz
Welche Bedeutung hat ein Kontaktpunkt in der jeweiligen Situation?
Bindungspotential
Würde der Kunde erneut beim Unternehmen einkaufen und seine Angebote weiterempfehlen?
Eigentümerschaft
Werden die Kontaktpunkte vom Unternehmen selbst oder von Dritten kontrolliert?
In einem sechsstufigen Verfahren lassen sich diese Parameter messen und die Messergebnisse gezielt für eine optimale Customer Experience einsetzen:
1. Zielvorstellung entwickeln
In einem Kundenbeziehungsmodell werden die Zielgruppen und ihre wichtigsten Vernetzungsmuster mit dem Unternehmen analysiert. In einem Kundenwertversprechen wird beschrieben, welchen Mehrwert das Unternehmen seinen Kunden verspricht. So entsteht ein Zielbild, an dem sich die Messverfahren orientieren können.
2. Kundenperspektive einnehmen
In Feldstudien werden Kunden beim Durchlaufen der Customer Journey begleitet. Auf diese Weise können Unternehmen die Perspektive der Kunden einnehmen und ein Verständnis für ihre Fragen, Motive und Erwartungen entwickeln. In Form von Storys werden die Erlebnisse an den Kontaktpunkten festgehalten.
3. Wesentliches fokussieren
Gemeinsam mit Kundenvertretern werden sämtliche Kontaktpunkte entlang der Customer Journey identifiziert und bewertet. Dazu stufen die Kunden jeweils auf einer Skala von Null bis Zehn ein, wie wichtig ihnen ein Kontaktpunkt ist, ob sie an diesem Kontaktpunkt wieder kaufen und ob sie ihn weiterempfehlen würden. So lässt sich ausschließen, dass das Unternehmen in Leistungen investiert, die für den Kunden unerheblich sind.
4. Erlebnisse strukturieren
Die in den Storys festgehaltenen Erlebnisse werden für die einzelnen Kontaktpunkte auf einer mehrstufigen Skala von „begeistert“ bis „unerfüllt“ aufgeschlüsselt. Mit einer so genannten Customer Experience Map lässt sich anhand dieser Skala übersichtlich darstellen, wie die tatsächlichen von den gewünschten Erlebnissen abweichen. Der konkrete Optimierungsbedarf ist dadurch klar ersichtlich.
5. Entscheidungsarchitektur schaffen
In einer Touchpoint Performance Matrix werden sämtliche Ergebnisse zusammengefasst. Die Matrix bildet ab, welche Touchpoints die höchste Relevanz aufweisen, wie die Erlebnisse aktuell dort aussehen und ob das Unternehmen diese Touchpoints derzeit selbst steuern kann. Damit wird eine Entscheidungsarchitektur geschaffen, die priorisierte Handlungsfelder offenlegt.
6. Wirksamkeit überprüfen
Das Verhalten und die Erwartungen der Kunden unterliegen einem permanenten Wandel. Neue Lösungen, die auf Basis der Touchpoint Performance Matrix umgesetzt wurden, müssen deshalb in iterativen Zyklen immer wieder auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Entscheidend ist, dass dabei die Kunden in den Feedbackprozess einbezogen werden.